Arbeitsbereich Zeitgeschichte
Der Arbeitsbereich Zeitgeschichte
Der Arbeitsbereich für Zeitgeschichte wurde 1984 am Institut für Geschichte eingerichtet. Unsere Forschungsschwerpunkte erstrecken sich von globaler Zeitgeschichte bis hin zu Kriegs-, Migrations- und Technikgeschichte. Die Professur für Zeitgeschichte mit dem Schwerpunkt Globale Zeitgeschichte hat Christiane Berth im August 2020 übernommen (Standort Institut für Geschichte, Attemsgasse 8/II). Auf Basis der Partnerschaft mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung wurde 2019 eine zweite Professur für Europäische Zeitgeschichte mit dem Schwerpunkt Konflikt- und Migrationsforschung eingerichtet (Standort Ludwig Boltzmann Institut, Liebiggasse 9).

Der Arbeitsbereich Zeitgeschichte erforscht globale, regionale und lokale Veränderungsprozesse in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Wir beschäftigen uns mit der Zeit vom späten 19. Jahrhundert bis ins frühe 21. Jahrhundert - unsere breit gespannten Forschungsnetze reichen dabei von Graz nach Kanada, Russland, Westafrika, China, Japan und Lateinamerika.
Für unsere Forschung nutzen wir Methoden der Kultur-, Sozial- und Technikgeschichte, lassen uns aber auch interdisziplinär inspirieren. Dies hilft uns, die vielfältigen Quellen der Zeitgeschichte wie digitale Bilder, Filme, Radiosendungen oder Interviews mit Zeitzeug:innen angemessen auszuwerten.
Unsere Forschungsschwerpunkte
Globale Zeitgeschichte
Die Welt des frühen 21. Jahrhunderts ist global vernetzt: Waren, Konsumgewohnheiten und Menschen reisen über Ländergrenzen und Kontinente; Nachrichten und Informationen verbreiten sich neben den etablierten Medien über soziale Netzwerke und überqueren in Bruchteilen von Sekunden den ganzen Planeten. Ermöglicht wird dies durch technische Infrastrukturen: Kabel durchqueren ganze Ozeane, Satelliten umkreisen die Umlaufbahn der Erde.
In einer derart vernetzten Welt besteht die Notwendigkeit, historische Phänomene in ihren globalen Dimensionen zu erfassen. Im Forschungsschwerpunkt Globale Zeitgeschichte erforschen wir die Entwicklung dieser globalen Verflechtungsprozesse in Technik, Wirtschaft, Konsum, Wissenschaft und Kommunikation. Wir analysieren, wie sich Akteur:innen in verschiedensten Weltregionen globalen Herausforderungen stellten, sei es bei der Bekämpfung von Hunger oder dem Aufbau von Infrastrukturen. Dabei interessieren wir uns für die Biografien, Mobilitäten, Wissensbestände und Alltagserfahrungen der betroffenen Menschen, aber auch für die zu Grunde liegenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen.
Methodisch basieren unsere Forschungen auf aktuellen Konzepten aus Global-, Kultur- und Sozialgeschichte sowie den Medienwissenschaften, der kulturwissenschaftlichen Raumforschung und den Science and Technology Studies.
Europäische Zeitgeschichte: Konflikt- und Migrationsforschung
Kriege und Konflikte hören nicht auf, wenn die Waffen schweigen. Sie haben Vorgeschichten und sie haben Folgen. Inwiefern diese Folgen noch Jahrzehnte später spürbar sind, ist Gegenstand zeithistorischer Forschung und Lehre in diesem Bereich. Dazu gehören staatliche, gesellschaftliche, ökonomische sowie soziale, humanitäre und kulturelle Folgen der beiden Weltkriege und des Kalten Krieges. Besondere Schwerpunkte liegen zudem auf den Themen Migration im 20. Jahrhundert und Kindern des Krieges in Zentral- und Osteuropa sowie in der Sowjetunion.
Zur europäischen Zeitgeschichte mit dem Schwerpunkt Konflikt- und Migrationsforschungen führen wir Lehr- und Forschungsprojekte durch, die durch innovative Fragen den Erkenntnisfortschritt in diesem Zusammenhang vorantreiben. Der Arbeitsbereich zeichnet sich u. a. durch internationale und interdisziplinäre Vernetzung sowie durch gesellschaftspolitisch relevante Fragenstellungen aus. Durch den im August 2018 abgeschlossenen Partnervertrag zwischen der Universität Graz und dem Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung (BIK) besteht ein enger Austausch zwischen Forschung, Lehre und Vermittlung. So können Studierende Praktika absolvieren oder auch erste Erfahrungen im Wissenschaftsbereich sammeln.
Gedächtnispolitik und Erinnerungskulturen
„Gedächtnis“ spielt eine zentrale Rolle in den gesellschaftlichen Ausverhandlungen von Identität und Zugehörigkeit und in den Konflikten um politische Macht und kulturelle Hegemonie. Insbesondere seit den 1980er Jahren und der Rezeption des mehrbändigen, von Pierre Nora herausgegeben Werkes „Les lieux de mémoire“ setzt sich die Geschichtswissenschaft mit Diskursen und Ausdrucksformen des kollektiven Gedächtnisses theoretisch wie empirisch auseinander und reflektiert ihre eigene Rolle als Teil gesellschaftlicher Erinnerungskämpfe. Gedächtnisgeschichte als thematischer Fokus nahm im Arbeitsbereich Zeitgeschichte in den später 1980er Jahren ihren Anfang mit der Erforschung der Waldheim-Affäre und den erinnerungskulturellen Debatten zum NS-Regime und dem Zweiten Weltkrieg. Daraus entstand eine Kontinuität der Arbeit in Forschung und Lehre zu diesem Schwerpunkt mit einer großen Bandbreite an Fragestellungen.
Sie basiert auf den kulturwissenschaftlich ausgerichteten gedächtnistheoretischen Ansätzen z.B. von Aleida und Jan Assmann, Astrid Erll oder Pierre Nora. Die Forschungen befassen sich mit der Rolle von Gedächtnisdiskursen in politischen und gesellschaftlichen Konflikten. Dabei gilt das Interesse der Vielstimmigkeit der Erinnerungserzählungen, die damit der Vorstellung von homogenen (v.a. nationalen) Gedächtnissen widerspricht. Untersucht werden dabei unterschiedliche Repräsentationen des Gedächtnisses – politische Texte ebenso wie Zeichensetzungen im öffentlichen Raum (Denkmäler, Straßennamen etc.) und performative Akte (Feiertage/Feste, Einweihungen etc.), „hochkulturelle“ wie populärkulturelle Medien. Inhaltliche Schwerpunkte der letzten Jahre sind die Repräsentation von Kriegen und Gewalt im kulturellen Gedächtnis (Stichworte Kriegsdenkmal und Revolutionsdenkmal) sowie von politischen Regimen. Diskursanalytische, bild- und medienwissenschaftliche Ansätze machen dabei den interdisziplinären Zugang zu diesem Forschungsbereich deutlich.
Unsere Forschungsprojekte
Globale Arbeitswelten im Wandel: Die Geschichte von Technik, Geschlecht und Emotionen seit den 1960er Jahren
Leitung: Christiane Berth
Laufzeit: 2022-2024
Fördergeber: Elisabeth-List-Fellowship-Programm für Geschlechterforschung
Im frühen 21. Jahrhundert ist eine lebhafte Debatte um die Zukunft von Arbeit entbrannt, die phasenweise sehr emotional geführt wird. Digitale Technik hat die globalen Arbeitswelten bereits seit Jahrzehnten geprägt und immer wieder Ängste über den Verlust von Arbeitsplätzen ausgelöst. Während der Corona-Pandemie erreichte der Einsatz digitaler Technik seinen vorläufigen Höhepunkt und damit auch die Tendenz zur Flexibilisierung und Entgrenzung von Arbeit.
Das Forschungsprojekt befasst sich aus historischer Perspektive mit der Veränderung globaler Arbeitswelten. Es analysiert, wie sich das Verhältnis von digitaler Technik, Geschlechterverhältnissen und Emotionen in verschiedenen Arbeitsfeldern wandelte, darunter Büroarbeit, Industrie sowie landwirtschaftliche Produktion. Der vergleichende Blick auf die Entwicklungen in Europa, Südostasien und Lateinamerika ermöglicht Aussagen über unterschiedliche Zeitverläufe, globale Ungleichheit im Zugang zur Technik sowie die vielfältige Ausgestaltung von Geschlechterrollen.
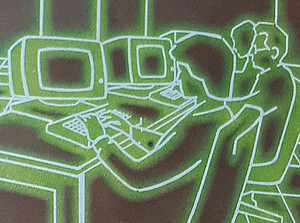
Fellows
Christiane Berth (Leitung): christiane.berth(at)uni-graz.at
Anna Baumann (SNF-Fellow): anna.baumann@unibe.ch – 1.3.-31.8.2024
Mike Prentice: mike.prentice(at)sheffield.ac.uk – Juni/Juli 2024
Monika Arnez: monika.arnez(at)upol.cz - Februar/Mai 2024
Helen Glew: H.Glew(at)westminster.ac.uk – Mai/Juni 2023
Nina Jahrbacher: nina.jahrbacher(at)uni-graz.at – 1.4.2022-30.6.2023
Martina Heßler: hessler(at)pg.tu-darmstadt.de – 15.7.-1.8.2022 u. Mai 2023
Heidi Schweickert: heidi.schweickert(at)web.de – 1.6.-30.9.2022

A history of "Making Things" in West Africa, 1920-1980
Mitarbeiter:innen: Mag.phil. Katharina Oke, PhD
Laufzeit: 1.9.2022-28.2.2025
Fördergeber/Förderprogramm: Europäische Kommission/H2020
Das Projekt “A history of ‘Making Things’ in West Africa, 1920-1980: creating, meaning making, and experience” fokusiert auf handwerkliche Produktion und Kunsthandwerk in Accra und Lagos. Es nähert sich produktiven Prozessen mit einem Fokus auf den Schaffungsprozess und der sozio-kulturellen Bedeutung des „Dinge Machens“ an. Ziel des Projektes sind, erstens, historische Wissenssysteme und Erfahrungen des „Dinge Machens“ während und nach der formalen Kolonialherrschaft zu beleuchten. Zweitsens, einen Beitrag dazu zu leisten, unternehmerische Tätigkeiten als Teil der Sozial-, Kultur- und politischen Geschichtsschreibung zu Afrika zu etablieren. Sich unternehmerischer Tätigkeit zuwendend, versucht das Projekt gleichzeitig einen reduktiven Fokus auf Fragen der Kapitalakkumulation zu überwinden: Fragen nach dem „Dinge Machen“ erlauben einen historischen Einblick in die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagiert haben – einen Einblick, der keine binäre Unterscheidung zwischen „importiert“ und „lokal“ vorschreibt –, und erlaubt weiters eine Bandbreite an Motivationen für unternehmerische Tätigkeiten zu erahnen.
Das Projekt konzentriert sich auf Bäcker:innen und Goldschmied:innen und versucht so auch Einblick in unterschiedliche Laufbahnen des Kunsthandwerkserwerbs und Geschlechtergeschichte zu ermöglichen. Ziel des Projektes ist es eurozentrische Vorstellungen von Innovation und Technologie zu hinterfragen, und individuelles und kollektives Wissen zum Umgang mit widrigen ökonomischen Bedingungen während und nach der Kolonialherrschaft hervorzuheben. Auf diese Weise soll auch zu einer komplexeren Darstellung davon, wie West Afrikanische Gesellschaften Teil der wachsenden Literatur zur Globalgeschichte des Kapitalismus sowie der Wissenschafts- und Wissensgeschichte sind, geleistet werden.
Die Aktivitäten tschechoslowakischer Nachrichtendienste in Österreich im zentraleuropäischen Kontext 1948–1960.
Leitung: Barbara Stelzl-Marx
Laufzeit: seit März 2020
Fördergeber: FWF
Der österreichische Wissenschaftsfonds FWF beschloss im März 2020 die Förderung eines internationalen dreijähriges Forschungsprojekts zum Thema „Die Aktivitäten tschechoslowakischer Nachrichtendienste in Österreich im zentraleuropäischen Kontext 1948–1960. Netzwerke – Operationen – Wirkung“ (FWF P-33220 G) unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Barbara Stelzl-Marx. Es wird am Institut für Geschichte der Universität Graz in Kooperation mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung durchgeführt.
Bereits nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begannen die neu formierten tschechoslowakischen Nachrichtendienste ihre ersten Aktivitäten im benachbarten Österreich. Kurz nach der kommunistischen Machtübernahme im Februar 1948 nahmen diese Aktivitäten stark zu – Österreich wurde zu einer wichtigen Drehscheibe für Operationen gegen den „Westen“. In der ersten Hälfte der 1950er-Jahre, während der Besatzungszeit, wurden viele aus Sicht der Sowjetunion kritische Operationen von tschechoslowakischen Netzwerken und ihren Mitarbeitern durchgeführt. Dem US-amerikanischen Counterintelligence Corps (CIC, militärische Spionageabwehr) zufolge gehörten die tschechoslowakischen Nachrichtendienste zu den „aktivsten“ Diensten aus Osteuropa, die gerade auf österreichischem Gebiet eine entscheidende Rolle im aufkommenden Kalten Krieg spielten.
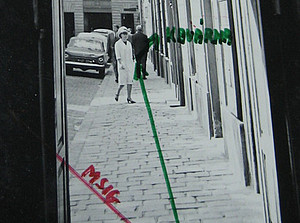
Die tschechoslowakischen Aktivitäten in Österreich insgesamt sind bislang kaum erforscht. Das vom FWF geförderte Projekt hat eine systematische Analyse der Aktivitäten der tschechoslowakischen Residenturen (nachrichtendienstlichen Stützpunkten) in Wien und Salzburg und deren Personals in der ersten Hälfte des Kalten Krieges zum Ziel, mit Vergleichen zu anderen wichtigen Stationen der tschechoslowakischen Dienste. Zentrale Fragestellungen sind etwa, wie die dafür notwendigen, geheimem Netzwerke geschaffen, erhalten und abgesichert, welche operativen Methoden angewandt und welche Ziele verfolgt wurden. Die Ergebnisse des Projektes werden damit einen wichtigen Beitrag zu den Cold War Studies leisten.
Das Projekt wird von Univ.-Prof. Dr. Barbara Stelzl-Marx geleitet, Professorin für Europäische Zeitgeschichte an der Universität Graz und Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung. Mag. Dieter Bacher ist für die Koordination zuständig und führt die Nachforschungen in britischen und US-Archiven durch, und Mag. Philipp Lesiak zeichnet sich für die Recherchen in tschechischen, slowakischen und österreichischen Archiven verantwortlich.

Die Polizei in Österreich: Brüche und Kontinuitäten 1938-1945
Mitarbeiter:innen: Univ.-Prof. Dr. Barbara Stelzl-Marx, Dr. Kurt Bauer, Mag. Nadjeschda Stoffers, Richard Wallenstorfer, BA, u.a
Fördergeber: Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich
Durchgeführt am Institut für Geschichte der Universität Graz, in Kooperation mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung
Projektpartner: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, KZ-Gedenkstätte Mauthausen
Seit Anfang 2022 führt die Universität Graz in Kooperation mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und dem Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung ein Forschungsprojekt zum Thema „Die Polizei in Österreich: Brüche und Kontinuitäten 1938–1945“ durch. Im Rahmen dieses vom österreichischen Innenministerium geförderten Projektes soll ein erster Beitrag zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte des wichtigsten Exekutivkörpers der Zweiten Republik geleistet werden. Kenntnisse um die Bedeutung, Funktion und Entwicklungsgeschichte der NS-Organisationen mit polizeilicher Funktion, den Missbrauch von Polizeibefugnissen im Rahmen eines totalitären Unrechtsstaates und deren konkreter Bezug zu Österreich – beziehungsweise zu Österreicherinnen und Österreichern – sind hierbei von großem Stellenwert. Im Fokus stehen zudem die gerichtliche Ahndung und Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit.
Mitgenommen. Ukrainische Flüchtlinge in Österreich im Spiegel mobiler Dinge
Mitarbeiter:innen: Univ.-Prof. Dr. Barbara Stelzl-Marx, Dipl.-Psych. Irina Malikova
Laufzeit: 2022-2025
Fördergeber: TU Graz, Universität Graz, Land Steiermark
„Es war einfach schwer zu entscheiden, was man mitnimmt, wenn man nicht weiß, ob man wieder zurückkommt“, erzählt eine Ukrainerin, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 in den Westen floh. Ziel des Projekts ist es, mittels Oral History Interviews persönliche Geschichten von ukrainischen Flüchtlingen in Österreich zu dokumentieren und in Form einer reich bebilderten Publikation der Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Zentrum steht dabei jeweils ein Gegenstand, der aus der Heimat mitgenommen wurde, und als Ausgangspunkt für die autobiographischen Erzählungen der geflüchteten Menschen dienen soll. Die Erfahrung des Krieges, die Etappen der Flucht und schließlich das Leben fern der Heimat können im Spiegel des ausgewählten Objektes beleuchtet werden. „Mitgenommen“ steht für das „mobile Ding“, aber auch für die prekäre Situation der betroffenen Menschen, auf die aufmerksam gemacht werden soll.
Durchführung: Institut für Geschichte der Universität Graz in Kooperation Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung


Zusatztafeln für personenbezogene Grazer Straßennamen Umsetzung des Maßnahmenkataloges
Mitarbeiter:innen: Univ.-Prof. Dr. Barbara Stelzl-Marx
Laufzeit: 2020-2024
Grazer Straßen und Plätze, die nach Personen benannt sind, werden mit Begleittafeln ausgestattet, anhand derer die namensgebende Person historisch eingeordnet werden kann. Zudem werden Biografien zu den rund 750 personenbezogenen Straßennamen erstellt, die auf der Homepage der Stadt Graz in einer georeferenzierten Karte veröffentlicht werden.
Telefonieren in Lateinamerika: Technikvisionen, Macht und soziale Beziehungen, 1970-2010
Univ.-Prof. Dr. Christiane Berth
Das Telefonnetz war ein wichtiger sozialer Bezugspunkt in der Zeitgeschichte Lateinamerikas. Um das Telefon kristallisierten sich Wünsche, Hoffnungen, Ärger, Entwicklungsvisionen und soziale Regeln. Telefonzentralen und öffentliche Fernsprecher galten einerseits als Symbol für Fortschritt. Firmen und Politiker:innen entwarfen eine idealisierte Version des Telefonnetzes: Weiße Nutzer:innen in urbanen Zentren demonstrierten ihrer Meinung nach die Modernität lateinamerikanischer Gesellschaften. Konträr dazu standen die Erfahrungen von vielen Nutzer:innen, die mit unterbrochenen Gesprächen, schlechter Übertragungsqualität oder defekten Apparaten kämpften.
So entwickelten sich Telefone andererseits zu einem Symbol für schlechten Service und die politische Vernachlässigung von Infrastrukturen. Seit den 1980er Jahren gab es heftige politische Auseinandersetzungen über die Privatisierung der Telefonfirmen. Parallel dazu begannen Experimente mit Handys, die im 21. Jahrhundert das Festnetz ablösten und öffentliche Fernsprecher bedeutungslos werden ließen. Das Projekt analysiert die Wechselwirkungen zwischen der politischen Ökonomie der Telekommunikation, staatlicher Regulierung sowie neuen Techniken und Nutzungsformen.

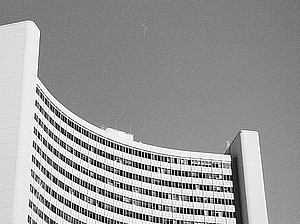
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO): Humanitarismus und technische Hilfe (1966–1992)
Dr.in Sarah Knoll, MA
Die UNIDO, die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, wurde 1966 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen gegründet. 1975 folgte die Umwandlung in eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Zu ihren zentralen Aufgaben gehört es, die Industrialisierung von sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und über diesen Weg ökonomisches Ungleichgewicht und Armut zu bekämpfen. Diese Ziele haben auch im 21. Jahrhundert nichts an Brisanz verloren. Dementsprechend stellt sich die Frage, welche Lehren aus den bisherigen Erfahrung der UNIDO für die Zukunft von Entwicklungszusammenarbeit und technische Unterstützung gezogen werden können.
Das Forschungsprojekt untersucht die Geschichte und Bedeutung der UNIDO zwischen Entwicklungshilfe, Dekolonialisierung und humanitären Strategien zur Bekämpfung globaler Entwicklungsunterschiede von der Gründung 1966 bis zur Umstrukturierung der Organisation in den frühen 1990er Jahren. Ein Fokus liegt dabei auf der Gründungsphase der Organisation sowie auf zwei Fallstudien, welche UNIDO-Projekte in Afrika und Asien in den Blick nehmen. Das Projekt betrachtet die UNIDO dabei als eigenständigen Akteur und als Plattform, wo verschiedene Interessen von Politik, NGOs und UNO zusammentreffen.
Leitenden Forschungsfragen:
- Welche Rolle spielte die UNIDO bei der Industrialisierung und Technologisierung von Ländern des globalen Südens?
- Welche technischen und ökonomischen Konzepte wurden von der UNIDO gefördert?
- Was gelang und was gestaltete sich als Herausforderung bei der Durchführung der Projekte?
- Wie sehr konnten Länder des globalen Südens die Organisation UNIDO und ihre Projekte vor Ort mitgestalten?
Ziel ist es die UNIDO als Akteur in die Geschichte von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit einzuschreiben und zu analysieren, welche Rolle die Organisation bei der Industrialisierung und Technologisierung von Staaten des globalen Südens spielte.
Publikationen des Arbeitsbereichs Zeitgeschichte
Globale Zeitgeschichte
Berth, Christiane / Wieters, Heike (2021): "Wonder Foods" to End World Hunger? International Organizations, NGOs, and Industrial Actors in Global Nutrition, 1940s to 1970s.
In: Zeithistorische Forschungen 18.2, S. 307-330.
Berth, Christiane (2021): Food and Revolution. Fighting Hunger in Nicaragua, 1960-1993. Pittsburgh. University of Pittsburgh Press.
Kotik, Tanja (2021): Das ost-südostasiatische Weltsystem, seine Integration in das moderne Weltsystem und staatliche Transformation in China, ca. 1500 bis 1900. In: Zeitschrift für Weltgeschichte. 22,1-2. 2021. S. 231-256.
Berth, Christiane (2020): "Kaffee, an dem Blut klebt" - Konsumboykotte gegen lateinamerikanische Diktaturen.
In: Bulletin Verein Schweizerischer GeschichtslehrerInnen. S. 22-26.
Berth, Christiane (2020): Zwischen Hoffnung, Stolz und Wut. Die emotionale Aneignung des Telefons in Mexiko, 1930er bis 1980er Jahre.
In: Heßler, Martina (Hg.): Technikemotionen. Paderborn. Ferdinand Schöningh. S. 229-249.
Berth, Christiane (2020): ITU, the Development Debate, and Technical Cooperation in the Global South, 1950-1992.
In: Gabriele Balbi, Andreas Fickers (Hg.): History of the International Telecommunication Union (ITU). Transnational Techno-Diplomacy from the Telegraph to the Internet. Berlin/Boston. De Gruyter Oldenbourg. S. 77-106.
Berth, Christiane; Pineda, Yovanna; Wolfe; Mikael (2020): Dialogues: History of Technology in Africa and the Americas in the Twentieth Century - Blog article Technology's Stories.
Berth, Christiane (2020): Fear, Curiosity and New Social Rules: Representations of Early Telephone Use in Latin America, 1880-1935. - Blog article Technology's Stories.
Gedächtniskultur und Erinnerungsforschung
Suppanz, Werner (2023): Das Denkmal des unbekannten Soldaten. Ein nicht verwirklichtes Projekt in der österreichischen Ersten Republik. In: Richard Hufschmid, Karin Liebhart, Dirk Rupnow, Monika Sommer (Hg.): ErinnerungsORTE weiter denken. In memoriam Heidemarie Uhl. Wien. Böhlau. 2023. S. 337-348.
Suppanz, Werner (2023): "Gespenster des alten Österreich". Der Kampf um die Deutungsmacht über die habsburgische Vergangenheit in der Ersten Republik. In: Feichtinger, Johannes; Uhl, Heidemarie (Hg.): Das integrative Empire. Wissensproduktion und kulturelle Praktiken in Habsburg-Zentraleuropa. Bielefeld. transcript. 2023. 281-301.
Andrea Strutz (2022): Geschichtswerkstätten als Form erzählender Geschichtskultur
In: Rita Garstenauer et al. (Hg.), Geschichte, Erinnern, Erzählen. Historisch orientierte Biografiearbeit betreiben und erforschen, 2022, S. 112−117 (in Druck).
Stromberger, Monika (2020): Of Heroes, Victims and Enemies: A Comparison of Memorials for the Dead of the Second World War in Yugoslavia/Slovenia and Austria/Styria (1945-1961).
In: Frank Jacob, Kenneth Pearl (Eds.), War and Memorials. The Second World War and Beyond (= War (Hi) Stories 4), Paderborn et al., S. 73-104.
Krieg und Kriegsfolgen
Suppanz, Werner / Goll, Nicole M. (Hgg.) (2022): "Heimatfront". Graz und das Kronland Steiermark im Ersten Weltkrieg. Wien-Köln: Böhlau Verlag.
Suppanz, Werner / Goll, Nicole M. (2022): "Gerichtete Gesellschaft". Die Steiermark im "totalen" Krieg. In: "Heimatfront". Graz und das Kronland Steiermark im Ersten Weltkrieg. Wien-Köln: Böhlau Verlag, S. 7-30.
Suppanz, Werner / Lakitsch, Maximilian (Hgg.) (2022): Grazer Forschungsbeiträge zu Frieden und Konflikt. Graz: Graz University Library Publishing. Als open access online verfügbar (PDF).
Bacher, Dieter (2020): Intelligence services in occupied Austria: The Soviet side
In: Karner, Stefan / Stelzl-Marx, Barbara (Hg.), The Red Army in Austria. Aspects of Soviet Occupation 1945–1955. The Harvard Cold War studies book series. Lanham/Boulder/New York/Toronto: Plymouth.
Bacher, Dieter (2020): Zwischen Bleiben, Rückkehr und Weiterwandern? Fremdsprachige Displaced Persons in Niederösterreich 1945–1955.
In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (ÖZG), 1/2020 „Migrationswege“, S. 139–163. Auch als open access online verfügbar (PDF).
Bacher, Dieter (2020): Collecting the Shreds. Former Austrian POWs in the Soviet Union as a Source of Information for British Secret Services in Early Cold War Austria.
In: Frank Jacob, Stefan Karner (eds.): War and Veterans. Treatment and Reintegration of Soldiers in Post-War Societies. Paderborn, S. 185–201.
Bachinger, Bernhard (2020): Challenge in the Balkans: The Experiential Worlds of German-speaking Soldiers on the Salonica Front 1915–1918.
In: Frank Jacob, Stefan Karner (eds.): War and its Aftermath. New York.
Bischof, Günter / Stelzl-Marx, Barbara / Bergmann-Pfleger, Katharina (2020): Auftrag Zukunft: 3000 Zeichen für Gedenken, Toleranz und Demokratie. 15 Jahre Zukunftsfonds der Republik Österreich. Wien/Köln/Weimar.
Karner, Stefan / Stelzl-Marx, Barbara (Hgg.) (2020): The Red Army in Austria: The Soviet Occupation, 1945–1955. The Harvard Cold War studies book series. Lanham/Boulder/New York/Toronto: Plymouth.
Knoll, Harald / Stelzl-Marx, Barbara (2020): Stalin’s Judiciary in Austria. Arrests and Convictions during the Occupation.
In: Stefan Karner, Barbara Stelzl-Marx (Hg.), The Red Army in Austria. Aspects of Soviet Occupation 1945–1955. The Harvard Cold War studies book series. Lanham/Boulder/New York/Toronto: Plymouth.
Ruggenthaler, Peter / Steiner, Anna (2020): Der Weg nach Helsinki. Entspannung mit Bonn als letzte Etappe auf dem Weg zur Einberufung der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
In: Michael Borchard, Stefan Karner, Hanns Jürgen Küsters, Peter Ruggenthaler (Hg.): Entspannung im Kalten Krieg. Der Weg zum Moskauer Vertrag und zur KSZE, Graz – Wien, S. 677-701.
Stelzl-Marx, Barbara (2020): Ivan’s Children, The Consequences of Sexual Relations between Red Army Soldiers and Austrian Women
In: Stefan Karner, Barbara Stelzl-Marx (Hg.), The Red Army in Austria. Aspects of Soviet Occupation 1945–1955. The Harvard Cold War studies book series. Lanham/Boulder/New York/Toronto: Plymouth.
Migration, Flucht und Exil
Knoll, Sarah (2023): Eine »Völkerwanderung«? Die Flucht aus Rumänien und die Flüchtlingspolitik in Österreich um 1990
In: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 19 (2022), H. 3
Andrea Strutz (2023): Internierung von Zivilpersonen und Geflüchteten als feindliche Ausländer während des Ersten und Zweiten Weltkriegs in Kanada. In: Gabriele Anderl (Hg.), Hinter verschlossenen Toren – die Internierung von Geflüchteten von den 1930er-Jahren bis in die Gegenwart. Wien: Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft 2023, S. 403−429.
Strutz, Andrea (2023): Forced to flee and deemed suspect: Tracing life stories of interned refugees in Canada during and after the Second World War
In: Gabriele Anderl, Linda Erker, Christoph Reinprecht (Hg.), Internment Refugee Camps. Historical and Contemporary Perspectives. Bielefeld: transcript 2022, S. 229−250 (peer reviewed).
Andrea Strutz (2021): Auswanderung aus Graz in der Nachkriegszeit - Versuch einer Darstellung
In: Historisches Jahrbuch der Stadt Graz, Band 51 (Migrationsraum Graz), 2021, S. 129−148 (reviewed).
Andrea Strutz (2021): Traveling knowledge: Refugees from Nazism and their Impact on Art Music and Musicology in post-1945 Canada
In: Susanne Korbel, Philipp Strobl (eds.): Mediations through Exile: Cultural Translation and Knowledge Transfer on Alternative Routes of Escape from Nazi Terror. London: Routledge 2021, S. 135−153 (peer reviewed).
Andrea Strutz (2020): Interned as “enemy aliens”: Jewish Refugees from Austria, Germany and Italy in Canada
In: Yearbook of the Research Centre for German and Austrian Exile Studies 20, ed. by Swen Steinberg and Anthony Grenville. Brill/Rodopi: Leiden, Boston, S. 46–67 (peer reviewed).
Nationalismus und Identitätskonstruktionen
Suppanz, Werner (2020): Othmar Spanns Schrifttum bis 1918.
In: Karl Acham unter Mitarbeit von Georg Witrisal (Hg.): Die Soziologie und ihre Nachbardisziplinen im Habsburgerreich. Wien-Köln-Weimar. Böhlau. S. 607-612.
Suppanz, Werner (2020): Karl Kautsky: Rasse und Judentum (1914).
In: Karl Acham unter Mitarbeit von Georg Witrisal (Hg.): Die Soziologie und ihre Nachbardisziplinen im Habsburgerreich. Wien-Köln-Weimar. Böhlau. S. 910-912.
Suppanz, Werner (2020): Friedrich Hertz: Moderne Rassentheorien. Kritische Essays (1904).
In: Karl Acham unter Mitarbeit von Georg Witrisal (Hg.): Die Soziologie und ihre Nachbardisziplinen im Habsburgerreich. Wien-Köln-Weimar. Böhlau. S. 906-910.
Suppanz, Werner (2020): Isidor Singer: Der Juden Kampf ums Recht (1902).
In: Karl Acham unter Mitarbeit von Georg Witrisal (Hg.): Die Soziologie und ihre Nachbardisziplinen im Habsburgerreich. Ein Kompendium internationaler Forschungen zu den Kulturwissenschaften in Zentraleuropa. Wien-Köln-Weimar. Böhlau. S. 902-906.
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen
Univ.-Prof. Dr. Christiane Berth
Ich forsche zur Geschichte von Kommunikation und Technik, Ernährung und Konsum sowie Welthandel und Migration. Mein aktuelles Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Globalgeschichte des modernen Büros.
Nach meiner Promotion zur Geschichte des Kaffeehandels an der Universität Hamburg (2010) forschte ich als Postdoc in der Schweiz zu Hunger und Ernährung in Lateinamerika. Dort entstand meine Habilitationsschrift, die 2021 unter dem Titel Food and Revolution. Fighting Hunger in Nicaragua, 1960-1993 bei University of Pittsburgh Press erschien.
Meine Forschungen führten mich unter anderem nach Costa Rica, Guatemala, Nicaragua und Mexiko sowie Paraguay und Kolumbien. Seit August 2020 bin ich Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Graz.

Univ.-Prof. Dr. Christiane Berth
Telefon:+43 316 380 - 2621
Ort:Institut für Geschichte
Öffnungszeiten:Dienstag, 14-15 Uhr
Nina Jahrbacher, BA MA
Nina Jahrbacher ist Doktorandin am Institut für Geschichte, Arbeitsbereich Zeitgeschichte, mit den Schwerpunkten Zeit- und Wirtschaftsgeschichte. In ihrer Masterarbeit, Die Anfänge der Südbahn im Herzogtum Steiermark. Räume und Menschen, ging sie der Frage nach, ob sich ökonomische Auswirkungen der Südbahn auf das (ehemalige) Herzogtum Steiermark bis 1870 feststellen lassen. Dabei zeichnete sie anhand der Paramater „Räume“ und „Menschen“ nach, wie sich dieser örtlich und zeitlich eingeschränkte Raum vor und während des Baus (1830–1857) sowie nach der Fertigstellung der Südbahn (1857–1870) entwickelte. In ihrer Dissertation und als Junior-Fellow des Elisabeth-List-Fellowship-Programms für Geschlechterforschung Globale Arbeitswelten im Wandel: Die Geschichte von Technik, Geschlecht und Emotionen seit den 1960er Jahren beschäftigt sie sich mit der Frage, welche Auswirkungen die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung auf die Verwaltung der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zwischen 1969 und 1991 hatte. Derzeit leitet sie die Organisation des 15. Österreichischen Zeitgeschichtetags (Graz 2024).

BA. MA. Nina Jahrbacher
Dr.in Sarah Knoll, BA MA
Sarah Knoll studierte Geschichte mit Schwerpunkt Zeitgeschichte an der Universität Wien. Ihre 2022 am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien abgeschlossene Dissertation handelte vom Umgang mit Flüchtlingen aus kommunistischen Regimen zwischen 1956 und 1989/90, unter besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit von NGOs und dem UNHCR. 2018 war sie Junior Visiting Fellow am Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva. Zuvor arbeitete sie als Projektmitarbeiterin am Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Humanitarismus und humanitäre Hilfe, Internationale Organisationen, Flucht und Migration im Kalten Krieg und österreichische Geschichte in internationalen Kontexten. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt untersucht sie die Geschichte der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).
Publikationsliste

BA. Dr.phil. MA. Sarah Knoll
Telefon:+43 316 380 - 8070
Ort:Institut für Geschichte
Öffnungszeiten:Mittwoch 12:30-13:30
Tanja Kotik, BA. MA.
Tanja Kotik arbeitet als Universitätsassistentin am Institut für Geschichte, Arbeitsbereich Zeitgeschichte.
In ihrem Dissertationsprojekt "Bilateral economic cooperation in times of systemic transformation: German-Chinese economic relations in the 1980s and 1990s" untersucht sie die Zusammenarbeit wirtschaftlicher und politischer Interessensvertreter der BRD in den bilateralen Beziehungen mit der Volksrepublik China. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Gründung und Förderung deutsch-chinesischer Joint Ventures.
In der Lehre liegen ihre Schwerpunkte auf der Wirtschafts- und Politikgeschichte Chinas und Ostasiens vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

BA. MA. Tanja Kotik
Telefon:+43 316 380 - 2620
Ort:Institut für Geschichte
Öffnungszeiten:nach Vereinbarung
Mag. phil. PhD Katharina Oke
Katharina Oke studierte Journalismus und Afrikawissenschaften in Wien. Im Anschluss daran absolvierte sie ein Doktoratsstudium in afrikanischer Geschichte/Globalgeschichte an der Universität Oxford. 2018 promovierte sie zu Zeitungskultur in Nigeria mit der Dissertation „The Politics of the Public Sphere. English-language and Yoruba-language Print Culture in colonial Lagos, 1880s-1940s”. Bevor sie Ende 2020 nach Graz kam, war Katharina Lecturer in Modern African History am King’s College, London, sowie TORCH Visiting Research Fellow an der Universität Oxford. Seit September 2022 ist sie Marie Curie Global Fellow in Partnerschaft mit der Universität Ibadan, Nigeria. Im Rahmen dieses Projektes – “A History of Making Things in West Africa” – forscht sie zu unternehmerischen Tätigkeiten, (kunst-)handwerklicher Produktion und Wissensproduktion in Accra und Lagos.

Mag.phil. PhD Katharina Oke
Telefon:+43 316 380 - 8086
Ort:Institut für Geschichte
Öffnungszeiten:Montags, 11-12
Dr. Monika Stromberger
Monika Stromberger studierte Geschichte an der Universität Graz und promovierte 2001 im Bereich Zeitgeschichte. 1992-2013 war sie in verschiedenen Forschungsprojekten tätig u.a. zu den Themen: Stadtforschung bzw. Moderne und Zentraleuropa um 1900 (SFB), Erster Weltkrieg, Nationalsozialismus in der Steiermark, Stadtplanung und Architektur nach 1945, Sozialistische Stadt (Ljubljana), Globalgeschichte im 20. Jahrhundert, Architektur und Konsumkultur; Ausstellungsprojekte zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (Wien) und zur Annenstraße (Graz). Ab 1994 war sie Externe Lektorin an der Universität Graz (einige Jahre auch an der TU Graz). Seit 2013 ist sie Senior Lecturer am Institut für Geschichte. Nebst Auszeichnungen für die Forschung erhielt sie 2018 den Lehrpreis der Universität Graz für Digitale Lehre.
Fokus der Forschungs- und Lehrtätigkeit: Stadt, Gedächtnispolitik, Visual History; Slowenien, Steiermark; E-Learning&Digitale Medien

Dr. Monika Stromberger
Telefon:+43 316 380 - 8071
Ort:Institut für Geschichte
Öffnungszeiten:n.V.
Priv.-Doz. Mag. Dr.in Andrea Strutz
Andrea Strutz studierte Geschichte und Philosophie an der Universität Graz. In ihrer Dissertation analysierte sie Maßnahmen zur „Wiedergutmachung“ für die Opfer des Nationalsozialismus in Österreich. Im Habilitationsprojekt untersuchte sie der Geschichte der österreichischen Migration nach Kanada unter besonderer Berücksichtigung der jüdischen Einwanderung. Sie lehrt seit 1993 an der Universität Graz und hat an zahlreichen Forschungs- und Ausstellungsprojekten am Institut für Geschichte (1998−2008), am LBI für Gesellschafts- und Kulturgeschichte (2001−6/2017) und am LBI für Kriegsfolgenforschung (seit 7/2017) mitgearbeitet. Derzeit erforscht sie das Weiterleben jüdischer NS-Flüchtlinge in Kanada mit den Schwerpunkten Flucht- und Integrationserfahrungen, Wissenstransfer und Genderaspekte.
Forschungs- und Lehrfelder: Migration und Exil, Jüdische Geschichte, Geschichte Kanadas, Biografieforschung, Gedächtnis und Erinnerung, Theorie und Praxis der Oral und Video History.
Funktionen in wissenschaftlichen Gremien (Auswahl): Mitherausgeberin der Zeitschrift für Kanada-Studien (ZKS); Network-Chair des Oral History and Life Stories Network der European Social Science History Conference (ESSHC).

Priv.-Doz. Mag. Dr.phil. Andrea Strutz
Telefon:+43 316 380 - 2618
Ort:Institut für Geschichte
Öffnungszeiten:Nach Vereinbarung per E-Mail (bevorzugt montags)
Assoz. Prof. DDr. Werner Suppanz
Werner Suppanz studierte Rechtswissenschaften (Doktorat 1984) und Geschichte (Doktorat 1993) an der Universität Graz. Er war von 1997 bis 2003 zunächst Lehrbeauftragter und Projektmitarbeiter, insbesondere im Rahmen des SFB „Moderne – Wien und Zentraleuropa um 1900“ (1996-2004). Seit 2007 ist er als Assistenzprofessor, seit der Habilitation 2017 zum Thema „Erinnerungslandschaften. Der Erste Weltkrieg in Diskursen und Topographien der 1920er Jahre“ als Assoziierter Professor im Arbeitsbereich tätig.
Arbeitsschwerpunkte: Gedächtnisgeschichte und Vergangenheitspolitik, Kulturgeschichte des Politischen und Politiken der Identität mit einem Fokus auf Nationalismus. In den letzten Jahren lag sein Fokus auf dem Ersten Weltkrieg sowie der Kultur- und Gedächtnisgeschichte von Kriegen.

Assoz. Prof. DDr. Werner Suppanz
Telefon:+43 316 380 - 8075
Ort:Institut für Geschichte
Öffnungszeiten:Parteienverkehr nach Terminvereinbarung
Studentische Mitarbeiter:innen
Linda Hackermüller
Linda Hackermüller studiert Lehramt mit der Fächerkombination Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung sowie Deutsch. Sie ist seit März 2024 als studentische Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Zeitgeschichte tätig und unterstützt das Team bei curricularen Aufgaben und administrativen Tätigkeiten.

Linda Hackermüller
Simone Hödlmoser
Ich habe im SS 2023 den BA Romanistik (Spanisch) abgeschlossen und studiere seit WS 2023 im MA Übersetzen und Dialogdolmetschen (Spanisch). Ich bin seit dem SS 2023 studentische Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Zeitgeschichte.

Simone Hödlmoser
David Wagner-Hackl
David Wagner-Hackl studiert zurzeit Geschichte im Bachelor und arbeitet seit Oktober 2022 als Studentischer Mitarbeiter im Arbeitsbereich Zeitgeschichte. Als Studentischer Mitarbeiter hilft er bei der Recherche, dem Vorbereiten von Lehrveranstaltungen und gemeinsamen Projekten. Zurzeit arbeitet er an einer Bachelorarbeit über die Berichterstattung von deutschsprachigen Medien im Vietnamkrieg.

David Wagner-Hackl
Koordinatorin des Arbeitsbereichs Zeitgeschichte
Univ.-Prof. Dr. Christiane Berth
Telefon:+43 316 380 - 2621
Ort:Attemsgasse 8/II, 8010 Graz
Öffnungszeiten:Dienstag von 14:00 bis 15:00 Uhr
Web: https://bit.ly/4bAT8SP