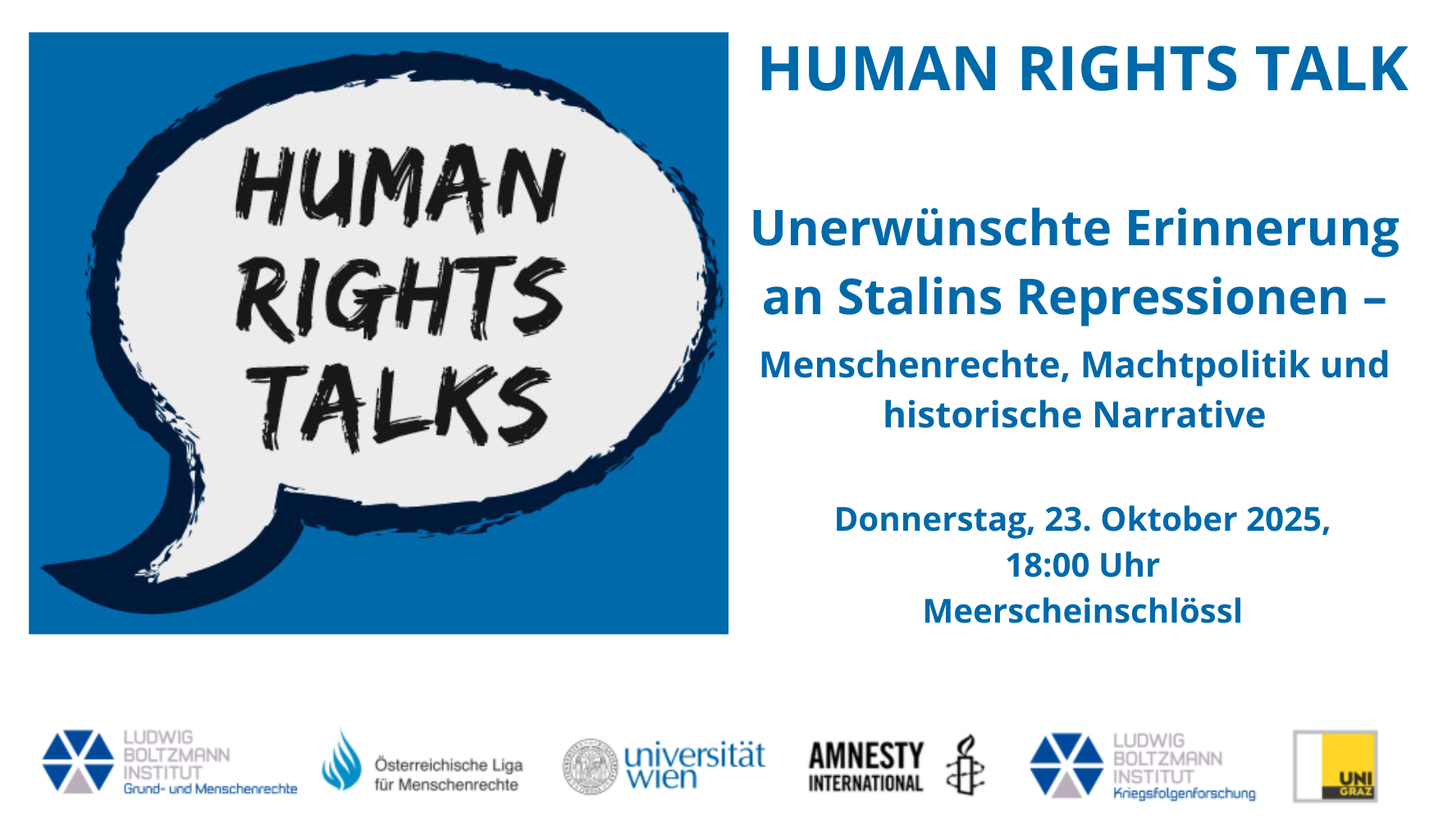Das Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte, das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung, die Österreichische Liga für Menschenrechte, Amnesty International Österreich und die Universität Wien laden mit freundlicher Unterstützung der Stadt Wien-MA7 sowie der Universität Graz zum HUMAN RIGHTS TALK ein.
Der „Große Terror“ markiert ein von Massenrepression und systematischer Verfolgung von „Volksfeinden“ geprägtes Zeitalter in der Sowjetunion, das seinen Höhenpunkt zwischen 1936 und 1938 erreichte. Allein in diesem Zeitraum kam es zur Verhaftung von etwa 1,5 Millionen Menschen. Ungefähr die Hälfte wurde erschossen, die andere wurde in die GULAGs – Konzentrations- und Straflager – verschleppt oder in Gefängnissen inhaftiert. Ungeachtet des gewaltigen Ausmaßes der Repression gab es keinen systematischen Versuch des russischen Staates, der Opfer zu gedenken und historische Gerechtigkeit herzustellen. Der Große Terror hat bei den Betroffenen, deren Nachkommen und der Zivilgesellschaft ein kollektives Trauma hinterlassen; Menschenrechtsorganisationen sind bis heute mit der Aufarbeitung beschäftigt.
Welche Verantwortung trägt der Staat für die Bewahrung des historischen Gedächtnisses und was passiert, wenn dieses stattdessen ausgelöscht wird? Wie haben Massenrepression und die sich wandelnde kollektive Wahrnehmung dieser Ereignisse die Entwicklung von Menschenrechtsbewegungen und der Zivilgesellschaft in der Sowjetunion und im heutigen Russland beeinflusst? Welche Verbindungen lassen sich zum politischen Kurs Russlands insgesamt herstellen, insbesondere im Hinblick auf Fälle von „selektivem Gedächtnisverlust“ als Teil der modernen antiwestlichen Propaganda? Nicht zuletzt lohnt ein Blick über die Grenzen hinaus: Welche Nachwirkungen entfalten die Massenrepressionen der Sowjetzeit bis heute auf internationaler Ebene? Und lassen sich in anderen Erdteilen ähnliche Tendenzen beobachten? Hochkarätige Expert:innen diskutieren die historischen und gegenwärtigen Auswirkungen der politischen Repression in der Sowjetunion auf Zivilgesellschaft und Menschenrechte.
PROGRAMM
Begrüßung
- Barbara STELZL-MARX, Direktorin, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung; Professorin für europäische Zeitgeschichte, Universität Graz
- Michael Lysander FREMUTH, Wissenschaftlicher Direktor, Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte; Professor für Grund- und Menschenrechte, Universität Wien
- Joachim REIDL, Vizerektor, Universität Graz
- Elvira WELZIG, Geschäftsführerin, Ludwig Boltzmann Gesellschaft
Keynote
- Nikita PETROV, stv. Vorsitzender, Forschungs- und Informationszentrums Memorial
Podiumsdiskussion
- Anna GRAF-STEINER, Post-Doc, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung
- Pavel KOGAN, Mitglied, Memorial's Friends in Austria, Forschungs- und Informationszentrum Memorial
- Sofiya LIPENKOVA, Projektmanagerin, Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte
- Nikita PETROV, stv. Vorsitzender, Forschungs- und Informationszentrums Memorial
- Anatoly RESHETNIKOV, Assistenzprofessor, Webster Vienna Private University
Publikumsdiskussion
Moderation
- Wolfgang MUELLER, stv. Institutsvorstand, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien
Im Anschluss: Empfang
TEILNAHME & ANMELDUNG
Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund des limitierten Platzangebotes bitten wir unter https://eveeno.com/354009119 bis Montag, 20. Oktober 2025 um Anmeldung. Wir bitten um Verständnis, dass ohne Anmeldung leider kein Einlass möglich ist.
Aus Sicherheitsgründen werden vor Beginn der Veranstaltung Taschenkontrollen durchgeführt. Wir ersuchen Sie daher, die Möglichkeit zum Einlass ab 17:30 zu nutzen.
Wir dürfen Sie ebenfalls informieren, dass während des Events Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden. Informationen zu unseren Datenschutzrichtlinien finden Sie hier.
Das Programm zum Download sowie weitere Details zur Veranstaltung finden Sie hier auf unserer Website.
Wir freuen uns darauf, Sie beim Human Rights Talk begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
Uros Prah & Irina Dietrich
im Namen des Ludwig Boltzmann Instituts für Grund- und Menschenrechte
und aller Kooperationspartner:innen