Der Arbeitsbereich Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie stellt sich vor
NEW(s): Aktuelles & Ankündigungen
Auszeichnung für Forschungsleistung
Wir freuen uns, dass unsere Mitarbeiterin Dr.phil. Hanna Stein das Post-Doc-Track Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erhalten hat, welches die Publikation ihrer 2024 abgeschlossenen Dissertation „Idiosyncratic and Useful Amateur Film(s). Creative and Pragmatic Practices and Representations of Everyday Life in Yugoslav Ciné Club Productions of the 1960s and 1970s” fördert.
Aktuelle Projekte
Refugees, migration and erased memories in the aftermath of Yugoslav wars
Networks of Photographic Practises in the Transimperial Caucasus
Creative and Pragmatic Practices and Representations of Everyday Life in Yugoslav Ciné Club Productions of the 1960s and 1970s Förderprogramm
UNSER TEAM: Wir stellen uns vor
Leiterin des Arbeitsbereiches
Univ.-Prof. Dr.Heike Karge
Heike Karge ist Professorin für Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie / Institut für Geschichte. Seit September 2023 leitet sie in dieser Funktion den Arbeitsbereich für Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie.
Curriculum Vitae
Heike Karge studierte zunächst Russisch in Leipzig und Kaluga, darauf folgte ein Studium der Geschichte, Ost- und Südosteuropawissenschaften und der Soziologie in Leipzig, Zagreb und Belgrad. Die Promotion erfolgte 2006 am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz mit der Dissertationsschrift „Steinerne Erinnerung - versteinerte Erinnerung? Kriegsgedenken im sozialistischen Jugoslawien“ (Wiesbaden: Harrassowitz, 2010: übersetzt: Sećanje u kamenu – okamjeno sećanje? Beograd: Biblioteka XX Vek, 2014). Im Jahre 2018 habilitierte sie sich an der Universität Regensburg, wo sie von 2008-2023 als Akademische Rätin/Oberrätin tätig war, mit einer Forschungsarbeit zur Kulturgeschichte der Psychiatrie in Südosteuropa (Der Charme der Schizophrenie. Psychiatrie, Krieg und Gesellschaft im serbokroatischen Raum, Berlin: De Gruyter 2021).

Univ.-Prof. Dr. Heike Karge

Mag. Dr.phil. Christian Promitzer
Christian Promitzer ist teilzeitbeschäftigter Vertragsassistent am Institut für Geschichte/Arbeitsbereich Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie.
Curriculum Vitae
Er hat sein Doktorat im Studium der Geschichte an der Universität Graz im Jahr 1997 abgeschlossen und ist seitdem an diesem Fachbereich angestellt. Er hat in mehreren geförderten Projekten Grundlagenforschung betrieben. Seine Schwerpunkte sind die Geschichte der seit 1918 faktisch bestehenden Grenze zwischen Österreich und Slowenien (früher Jugoslawien), die Geschichte von Epidemien und deren Bekämpfung im südöstlichen Europa im 19. und frühen 20. Jahrhundert, sowie zentraleuropäische Vorstellungen über den Balkan, insbesondere in Reiseberichten.
Mag. Dr.phil. Christian Promitzer
+43 316 380 - 8106
4369917712776
Institut für Geschichte
Zeit und Ort nach Vereinbarung
Mag. Dr.phil. Siegfried Gruber
Siegfried Gruber ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte/Arbeitsbereich Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie.
Curriculum Vitae
Er begann sein Studium der Geschichte und Volkskunde an der Karl-Franzens-Universität im Jahr 1988 und schloss es 1995 mit der Sponsion ab. Das Doktoratsstudium mündete in eine Promotion im Jahr 2004. Seit 1993 ist er in verschiedenen Forschungsprojekten als drittmittelfinanzierter wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte tätig. 2008 arbeitete er am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle (Saale) und von 2009 bis 2014 am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock, wo er am Aufbau der Forschungsdatenbank Mosaic (www.censusmosaic.org) beteiligt war.
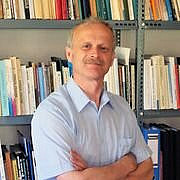
Mag. Dr.phil. Siegfried Gruber
+43 316 380 - 2377
+43 (0)664/5046815
Institut für Geschichte
nach Vereinbarung!
MMag. Dr.phil.Dominik Gutmeyr-Schnur
Dominik Gutmeyr-Schnur ist Universitätsassistent am Arbeitsbereich für Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie (Institut für Geschichte). Er ist Manager des EU-geförderten H2020-RISE-Projekts „Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities. Europe and the Black Sea Region.“
Curriculum Vitae
Dominik Gutmeyr-Schnur studierte Geschichte und Slawistik (B/K/S und Russisch) an den Universitäten Graz, Belgrad und Pula. 2016 promovierte er im Fach Geschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz mit der Dissertation „Borderlands Orientalism or How the Savage Lost His Nobility. The Russian Perception of the Caucasus between 1817–1878”, welche mit dem Josef-Krainer-Förderungspreis ausgezeichnet und 2017 publiziert wurde.
Er ist seit 2012 am Arbeitsbereich für Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie angestellt.

MMag. Dr.phil. Dominik Gutmeyr-Schnur
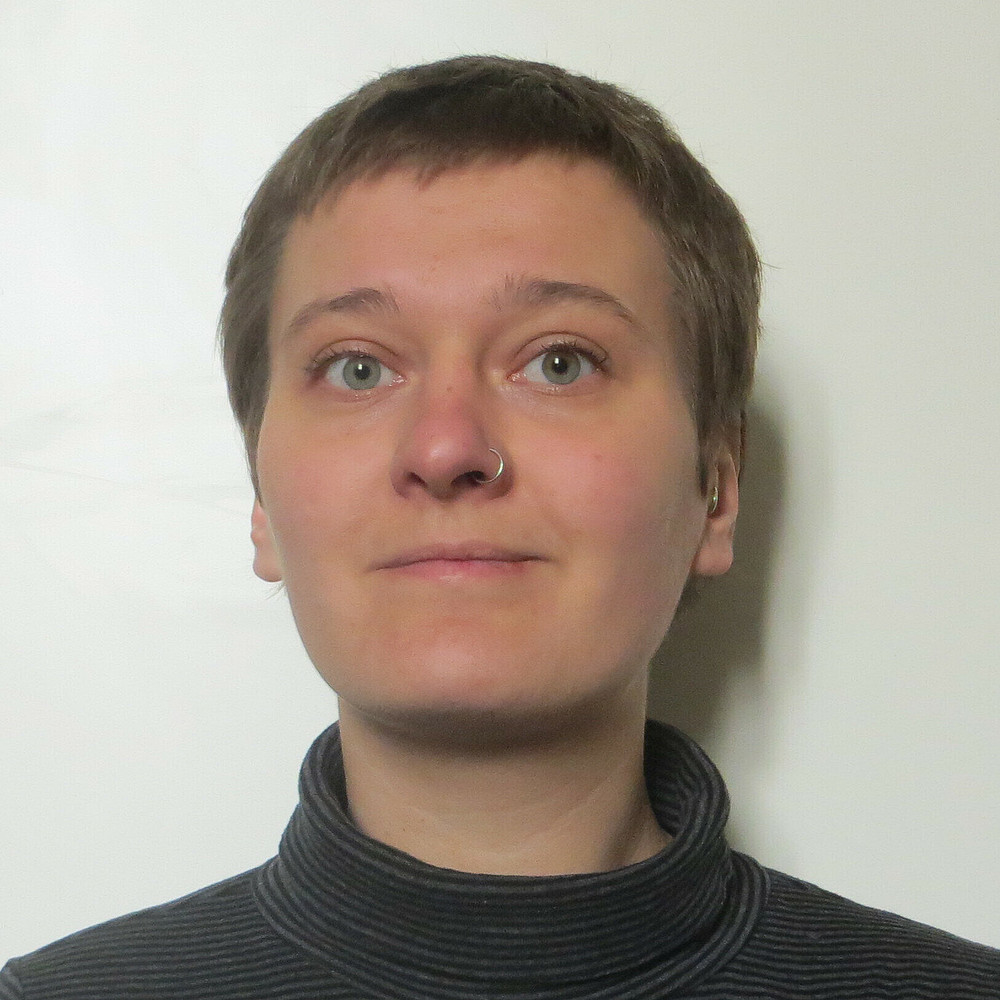
Dr.phil. MA. Hanna Stein
Hanna Stein ist Post-Doktorandin am Institut für Geschichte und Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Post-Doc-Track, März 2025–Juli 2025).
Curriculum Vitae
Hanna Stein studierte Europastudien und Kulturwissenschaften (BA, TU Chemnitz), Geschichte Südosteuropas (MA, Graz und Zagreb) und Interdisziplinäre Geschlechterstudien (MA, Graz). 2024 schloss sie ihre, von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften geförderte, Dissertation ab. In ihrer Forschung zu organisiertenAmateurfilmpraktiken der 1960er/70er Jahre in Jugoslawien zeigt sie, wie nicht-professionelle FilmemacherInnen politische und kulturelle Themen visuell verhandelten. Thematische und formale Analysen von mehr als 150 Filmen, Zeitschriften und Handbüchern ermöglichten es ihr, die Ambivalenzen des organisierten Amateurfilmschaffens an der Schnittstelle von politisch institutionalisiertem und rationalisiertem Bildungs- und Freizeitsystem einerseits und der Praxis kreativer und politischer Subjekte andererseits zu verstehen. Derzeit forscht sie zur Umweltgeschichte des Mülls in Jugoslawien. Ihre wissenschaftliche Arbeit verbindet sie mit künstlerischen Projekten.
Dr.phil. MA. MA. Hanna Stein
Ao.Univ.-Prof.i.R. Dr.h.c.mult. Dr.phil. Harald Heppner
Curriculum Vitae
Seit 1. März 1971 im Fachbereich tätig, hat Harald Heppner sein Doktoratsstudium 1975 abgeschlossen. 1983 hat er sich im Fach „Südosteuropäische Geschichte“ habilitiert und ist 1997 zum ao. Univ. Prof. ernannt worden. Heppner hat mehrere Forschungsaufenthalte absolviert: 1978 und 1986 in Bukarest, 1980 in Moskau und 1992 in Paris.
Heppners Forschungsfeld setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen:
- Österreichisch-südosteuropäische Beziehungen (16.-20.Jh.);
- Strukturphänomene in der Geschichte Südosteuropas;
- Die Rolle des 18. Jh. für die Entwicklung des südosteuropäischen Raumes; die Geschichte des Ersten Weltkrieges.

Ao.Univ.-Prof.i.R. Dr.h.c.mult. Dr.phil. Harald Heppner
+43 316 380 - 2361
Institut für Geschichte
nach Vereinbarung (per E-Mail oder Telefon)
BA. MA. MA. Christina Sterniša
Christina Sterniša ist Universitätsassistentin am Arbeitsbereich für Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie und forscht im Rahmen ihrer Dissertation zum Thema "The Solidarity / The City / The Heroines. Erinnerungspraxen des griechischen Widerstands."
Christina Sterniša absolvierte das Masterstudium Europäische Ethnologie und Kulturanthropologie an der Karl-Franzens-Universität Graz, sowie das Joint Master Degree Southeast European Studies in Graz und Belgrad. Während ihrer Master war sie als studentische wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie sowie als Projekt Assistentin am Geschichte Institut/Center for Southeast European Studies in Graz tätig. Für ihr Dissertationsprojekt erhielt sie das Marietta Blau Stipendium und eine Fellowship an der Panteion Universität Athen/Institut für Sozialanthropologie (2020-2021), sowie das Leopold-Kretzenbacher Stipendium des Schroubek Fonds Östliches Europa (2022). Sie ist Teil des internationalen PhD Programms Transformations in European Societies1 und des Redaktionsteams des kuckuck - notizen zur alltagskultur2.
Das Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit Erinnerungspraxen des griechischen Widerstands in Bezug auf die 1940er Jahre. Die Arbeit hinterfragt Romantisierungen, Heroisierungen und Hierarchisierungen des Widerstands, indem dem Dreigespann "the guns, the mountains, the heroes", das Narrative des Widerstands nach wie vor prägt, der Titel "the solidarity, the city, the heroines" gegenübergestellt wird. Der Fokus liegt damit auf einem breiten Verständnis von Widerstand, welches Praxen der Solidarität die häufig als weiblich assoziiert werden als pro-aktive Widerstandshandlungen begreift. Der Fokus liegt auf Erinnerungspraxen im Raum Athen.
Die Arbeit beschäftigt sich zudem mit dem Schreiben über das Beschweigen von (sexualisierter) Gewalt im historischen, sowie aktuellen Kontext der Feldforschung und integriert unterschiedliche Erzählformen und -formaten wie ethnographische Gedichte.
Die empirische Forschung stützt sich unter anderem auf Interviews mit unterschiedlichen Generationen von Aktivist*innen, Walk-Alongs mit Forschungspartner*innen, Memory Maps, teilnehmenden Beobachtungen u.a. an Gedenkorten, -feiern, und -protesten.
Forschungsschwerpunkte:
- Erinnerungskultur des Widerstands, Frauen* im Widerstand, Umgang mit sexualisierter Gewalt im Forschungskontext
- Veröffentlichungen: Die Gärten Kaisarianis. Erinnerungsrepertoires und -orte des Widerstands in Athen. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. 126,2 2023. S. 165-198.
- “In fact, it’s about mothers going to war or not. Even though male heroic stories are told over and over again.” An Essay on Fragmentary Memories of Resistance. In: Kuckuck. Notizen zur Alltaggskultur . 02/2023,memories. 2024. S. 75-79.
- Organisation:
- Schreibworkshop: Sexualisierte Gewalt und ihr Beschweigen in der ethnographischen und historisch-/anthropologischen Forschung.

Mag. Ma. Ma. Zsófia Turóczy
Zsófia Turóczy arbeitet seit Anfang November 2023 als Universitätsassistentin (Postdoc) am Arbeitsbereich für Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie.
Curriculum Vitae
Zsófia Turóczy studierte Germanistik, Ungarische Literatur und Sprachwissenschaft sowie Journalismus in Budapest und anschließend Südosteuropastudien in Jena. Danach war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) (2015-2016). Für ihr Dissertationsprojekt erhielt sie das SYLFF-Stipendium der Tokyo Fundation (2016-2018) und das Forschungsstipendium des DAAD (2017), womit sie drei Monate in Istanbul forschte. Anschließend verbrachte sie zwei Jahre in Albanien als DAAD-Sprachassistentin (2028-2020), wo sie an der Universität Tirana lehrte und die Auswahlprozesse für die DAAD-Stipendien mitorganisierte. Sie schließt gerade ihre Promotion zum Thema „Freimaurernetzwerken in Südosteuropa“ am Lehrstuhl für Vergleichende Kultur- und Sozialgeschichte der Universität Leipzig ab. Sie ist außerdem seit März 2023 Interimssprecherin der Jungen Südosteuropa-Gesellschaft. In dieser Funktion vertritt sie die Interessen der jungen Mitglieder innerhalb der SOG und organisiert sie die Vernetzung von jungen angehenden WissenschaftlerInnen und Südosteuropaexpert*innen.
In ihrer Dissertation untersuchte sie die Freimaurerei von Österreich-Ungarn auf ihre Netzwerke und Verflechtungen sowie die daraus resultierenden Transfer- und Austauschprozesse hin in der bislang vernachlässigten Raumkonstellation zwischen Ostmittel- und Südosteuropa. Sie arbeitete in der Dissertation heraus, wie die ungarische Elite die informellen Kanäle der Freimaurerei zum Zwecke des transimperialen Austausches und der eigenständigen Interessenvertretung genutzt hatte. Sie zeigt darüber hinaus, dass die ungarischen Freimaurer als Architekten des Imperiums gelesen werden können, die durch die freimaurerische Expansion in den südosteuropäischen Grenzgebieten an der (informellen) kolonisatorischen Tätigkeit der Doppelmonarchie teilnahmen. Ferner leistet die Arbeit einen Beitrag zur Dekonstruktion der verbreiteten Auffassung der Geschichtsschreibung, die die österreichisch-ungarische imperiale und koloniale Politik in Südosteuropa mit der cisleithanischen Außenpolitik gleichsetzt.
In ihrem neuen Forschungsprojekt untersucht sie die südosteuropäische Literatur in ihrem gesellschaftlichen, politischen und historischen Kontext. Dabei versteht sie Literatur als diskursiven Raum, in dem literarische Positionen ausgehandelt werden und symbolisches Kapital erkämpft wird. Konkret fokussiert sie sich am Beispiel der albanischen Literatur auf die Analyse der beteiligten Akteure und ihre Strategien, welche darauf abzielen, die albanischen Werke aus ihrer peripheren Lage in den Kanon der Weltliteratur zu integrieren. Hierbei werden die Kanonisierungsprozesse und die damit verknüpften Ungleichheits- und Machtverhältnisse aus einer postkolonialen Perspektive betrachtet und die Vorstellung einer homogenen Nationalliteratur kritisch hinterfragt. Zusätzlich gilt ihr Forschungsinteresse den Selbst- und Fremdbildern, der Erinnerungskultur und der Geschlechtergeschichte des südosteuropäischen Raums.

Dr.phil. MA. Elife Krasniqi
Elife (Eli) Krasniqi ist eine Anthropologin und Schriftstellerin. Ihre aktuelle Forschung konzentriert sich auf die Schwarze afrikanische Präsenz auf dem Balkan, insbesondere auf Menschen afrikanischer Herkunft, deren Vorfahren durch die osmanische Haussklaverei in die Region kamen. Mit einem visuell-anthropologischen Ansatz untersucht sie die Schnittstellen von Geschlecht, Rasse und Klasse im Alltag seit dem 19. Jahrhundert.
Ihre vorherige Forschung befasste sich mit den Transformationen albanischer Familienstrukturen, patriarchalen Systemen und feministischen Reaktionen vom mittleren 20. Jahrhundert bis zum frühen 21. Jahrhundert im Kosovo.
Krasniqi studierte Soziologie (BA, Universität Prishtina), Soziologie (MA, The New School for Social Research, New York) und Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie (Dr. phil., Universität Graz). Ihre akademischen Interessen liegen in visueller Geschichte und Anthropologie, feministischen und Erinnerungskulturen sowie der postkolonialen Theorie, mit einem besonderen Fokus auf Südosteuropa.
Seit über zwei Jahrzehnten ist sie im zivilgesellschaftlichen Sektor im Kosovo aktiv, forscht und leitet Programme, organisiert Diskussionen und öffentliche Veranstaltungen zu Frauenrechten und sozialer Gerechtigkeit. Sie war Mitbegründerin und Leiterin des Alter Habitus – Feminist Institute for Studies in Society and Culture in Prishtina (2009–2010; 2016–2018).
Neben ihrer akademischen Tätigkeit ist Krasniqi auch literarisch aktiv. Sie verfasste ein Theaterstück, das 2010 mit einem Preis des Nationaltheaters des Kosovo ausgezeichnet und 2017 veröffentlicht wurde, sowie eine Gedichtsammlung aus den Jahren 2012–2022, die 2022 erschien.
Evamaria Schafzahl (Sekretariat)
ist seit 1985 an der Universität Graz und seit 1990 am Institut für Geschichte (Arbeitsbereich Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie) tätig.

Studentische Mitarbeiter:innen



WISSEN ZUM AUSLEIHEN: Alles rund um unsere Bibliothek
Ausleihen, Recherchieren, Weiterdenken
Bestellungen und Kontakt
Bestellungen können entweder per E-Mail an suedost.bibliothek(at)uni-graz.at oder persönlich vor Ort während der Öffnungszeiten aufgegeben werden.
Öffnungszeiten der Fachbereichsbibliothek Südosteuropa
- Montag: 9:00–13:00 Uhr
- Freitag: 9:00–11:00 Uhr
In dieser Zeit ist auch der Lesesaal geöffnet.
Alternativ steht Ihnen der Lesesaal der Fachbibliothek in der Heinrichstraße 26, 4. Stock zur Verfügung.
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten auf der Homepage der Universitätsbibliothek.
Unsere Bestände sind über den Bibliothekskatalog Unikat recherchierbar.
Dank großzügiger Schenkungen – unter anderem aus den Bibliotheken von Balduin Saria, Ludwig von Gogolák, Robert Schwanke und Erich Beck – verfügt die Fachbereichsbibliothek über umfassende Bestände mit folgenden Schwerpunkten:
Spätantike und Mittelalter im Balkan- und Donauraum
Etwa 25 Prozent unseres Bestandes widmen sich der Geschichte dieser Regionen in der Spätantike und im Mittelalter.
Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Rund 70 Prozent der Bestände decken das südöstliche Europa und seine Länder in der Neuzeit ab.
Randgebiete
Ein kleinerer Teil (ca. 5 Prozent) behandelt angrenzende Regionen wie Tschechien, die Slowakei, Polen und Russland.
Historische Anthropologie
Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt auf der historischen Anthropologie – mit Fokus auf Südosteuropa, den Mittelmeerraum, den Nahen Osten und den Kaukasus.
Kartensammlungen
- Mehrere Tausend Militärkarten zum Donau- und Balkanraum aus dem späten 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg
- Atlas der Donauländer (abgeschlossene Edition)
- Atlas Ost- und Südosteuropa (abgeschlossene Edition)
Die vom US-amerikanischen Kulturanthropologen Joel M. Halpern (1929–2019, Professor emeritus an der University of Massachusetts at Amherst) dem Fachbereich überlassene Sammlung bietet zum Teil einzigartiges Material zum jugoslawischen Raum der letzten beiden Jahrhunderte.
Im Zentrum stehen Quellen, die grundlegende Einblicke in Haushalts- und Familienstrukturen ermöglichen – ideal für quantifizierende sozialhistorische Forschungen.
Dazu gehören:
- Zensusdaten
- Kirchenbücher (Matriken)
- Steuerlisten
- Status Animarum (Seelenstandstabellen)
Ergänzt wird der Bestand durch:
- Feldforschungsnotizen
- Interviewmaterialien
- Autobiografien
Eine umfangreiche Sammlung einschlägiger Monografien und Fachaufsätze zur Familiengeschichte des Balkans rundet die Sammlung ab.
Die albanologische Sammlung des Wiener Albanienkenners Robert Schwanke († 1993) wird am Fachbereich aufbewahrt und umfasst über tausend Bücher und Zeitschriftenbände.
Der Bestand enthält Monografien und Aufsätze zu folgenden Themenbereichen:
- Landeskunde
- Geschichte
- Kultur
- Sprachwissenschaft
- Politik Albaniens
Die Sammlung bietet eine wertvolle Grundlage für Forschung und Lehre im Bereich der Albanologie.
Der im Jahr 2007 von Dr. Erich Beck erworbene Bestand zur Bukowina stammt aus seiner privaten Bibliothek und erweitert gezielt die Sammlung Bucovinensia am Fachbereich.
Die Sammlung ergänzt die thematischen Bereiche:
- Südosteuropa
- Rumänien
- Ukraine
Sie umfasst:
- Monografien
- Sammelbände
- Separata
- Zeitschriftenbestände
Ein wertvoller Beitrag für alle, die sich mit der Geschichte und Kultur der Bukowina beschäftigen.
FORSCHUNG MIT FOKUS: Unser Forschungsfeld
Die Universität Graz ist die einzige Institution in Österreich, die sich in Forschung und Lehre explizit auf die Geschichte und Anthropologie Südosteuropas spezialisiert hat.
Diese Ausrichtung ist aus zwei Gründen besonders bedeutsam:
1. Geografische Nähe und historische Verflechtung
Aufgrund ihrer Lage spielte die Universität Graz schon immer eine wichtige Rolle in den Beziehungen zum südöstlichen Europa. Diese Verbindung war auch 1970 ausschlaggebend für die Gründung der Lehrkanzel für Südosteuropäische Geschichte – in Ergänzung zum Institut für Slawistik, das eine lange balkanologische Tradition pflegt.
2. Universitätsschwerpunkt „Südöstliches Europa“
Der universitäre Schwerpunkt verpflichtet uns über die akademische Forschung hinaus zu einer aktiven Rolle:
- Aufbau internationaler Kontakte
- Entwicklung wissenschaftlicher Netzwerke
- Organisation von Stipendien für Studierende aus Südosteuropa
- Konzeption und Unterstützung von Forschungsprojekten
Unsere Forschungsschwerpunkte
Die historische Erinnerung in der öffentlichen Sphäre und der damit verbundene Umgang mit der Vergangenheit bilden wichtige Forschungsschwerpunkte, die sich über eine Vielfalt an Themenbereichen erstrecken. Der öffentliche Gebrauch von Geschichte manifestiert sich in unterschiedlichen Bereichen. Die Analyse der Geschichtsbilder in Schulbüchern gehört genauso dazu wie die Betrachtungen zur shared history, die einer Trennung in „eigene Geschichtsbilder“ versus „Geschichtsbilder der Anderen“ entgegenzuwirken versucht. Ein zentraler Bereich ist die Historiographie des südöstlichen Europas und deren Wirkmächtigkeit in Sinnstiftung und Systemlegitimierung. Nicht zuletzt sind auch die Geschichtsnarrative in touristischen Kontexten Forschungsgegenstand, denn die Rahmung von Destinationen und Attraktionen durch textuelle und visuelle Geschichtsdarstellungen haben sich als wesentlicher Bestandteil national oder regional ausgerichteter Identitätspolitik im südöstlichen Europa erwiesen.
Der Forschungsschwerpunkt Historische Familien- und Geschlechterbeziehungen ist seit drei Jahrzehnten fest verankert und findet seine Begründung in der deutlich hervortretenden Familienzentriertheit in den Balkanländern. Die inneren Beziehungen der „Balkanfamilie“, wie sie vor allem im Westen der Balkanhalbinsel in Erscheinung traten, waren in der Vormoderne patriarchal, patrilinear und patrilokal strukturiert. Bedingt durch die Neuorientierungen in der postsozialistischen Periode, die jugoslawischen Kriege sowie das Wiedererstarken traditioneller Werte aus vorsozialistischer Zeit sind sowohl Re-Patriarchalisierungs- als auch scheinbare Verwestlichungstendenzen in den Familien- und Geschlechterbeziehungen festzustellen. Feministische Bewegungen haben es daher schwer, Fuß zu fassen. Die Forschungen zu den Familien- und Geschlechterbeziehungen sind interdisziplinär angelegt: Sie beziehen neben historischen auch soziologische, demografische und anthropologische Fragestellungen und Methoden ein.
Vor gerade einmal hundert Jahren wurde das Osmanische Reich als „kranker Mann am Bosporus“ bezeichnet. Die Konstruktion und Verwendung stereotyper Zuschreibungen sind Teil des Komplexes Orientalismus-Balkanismus und bilden ein wesentliches Element eines Forschungszuganges, der Bilder von Gesundheit und Krankheit in den Mittelpunkt stellt. Über symbolische Bedeutungen hinausweisend bildet die Sozialgeschichte der Medizin einen weiteren Schwerpunkt: Dieser behandelt das historische Auftreten von Epidemien, die gesellschaftliche Rolle von Ärzten und Ärztinnen sowie die Disziplinierung, Einteilung und Selektion der Bevölkerung durch Quarantäne, Desinfektion, Impfungen und weitere Hygienemaßnahmen sowie auch durch eugenische und rassenanthropologische Diskurse. Für die Bevölkerung der überwiegend agrarisch strukturierten Gesellschaften des Balkans stellen u.a. diese Maßnahmen eine frühe Berührungsfläche mit der Moderne dar.
Geschichte und Gegenwart des südöstlichen Europa sind ganz entscheidend von Migration geprägt. Aktuell gibt es kaum einen Bereich des gesellschaftlichen und politischen Lebens, der nicht unmittelbar von den Effekten der Migration betroffen ist. Diese Effekte sind vielschichtig und reichen weit über die Region hinaus. Die Erfahrung der Migration stellt häufig einen Bruch mit der eigenen Geschichte dar, sie erfordert eine Neuorientierung im Räumlichen und im Zeitlichen, und sie geht zumeist mit einem verstärkten Bedürfnis nach Verankerung und Sicherheit einher. Die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Migrationsprozessen stellt deshalb sowohl in theoretischer als auch in methodischer Hinsicht eine große Herausforderung dar. Historisch-anthropologische Zugangsweisen, die zur Anwendung kommen, erweisen sich als besonders geeignet, den vielschichtigen Migrationsphänomenen auf die Spur zu kommen.
Infolge der Projektionen der Orient-Okzident-Dichotomie wurden muslimische Kulturen lange Zeit als statisch und als „dem Westen“ unterlegen beschrieben. Sie hätten sich jeder Form von Innovation widersetzt, was man auf die Religion zurückführte. Unter Vermeidung dieses eurozentrischen und orientalisierenden Blickes und mit Verwendung des konstruktivistischen Ansatzes werden – bezüglich der europäischen und anatolischen Gebiete des Osmanischen Reiches und dessen Nachfolgestaaten sowie in Bezug auf muslimische Migrationsgesellschaften – gegenseitige Wahrnehmungs-, Austausch- und Visualisierungsprozesse von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart untersucht. Dadurch stehen anstelle der traditionellen philologischen Orientierung historisch-anthropologische sowie kultur- und sozialwissenschaftliche Aspekte im Vordergrund. Weitere Schwerpunkte liegen auf dem Umgang mit dem osmanischen Erbe sowie auf der Untersuchung von patriarchalen Strukturen und Geschlechterbeziehungen in muslimischen Gesellschaften in und außerhalb Kleineurasiens.
Mit dem Forschungsschwerpunkt Visuelle Kulturen stellen wir das (Audio-)Visuelle als Primärquelle in den Mittelpunkt theoretischer und methodologischer Zugänge. Wir analysieren visuelle Repräsentationen von kulturellen Erscheinungen, ihre Sichtbarkeit und auf die damit verbundenen Wahrnehmungen. Neben den Sichtbarkeiten fragen wir aber auch nach dem, was in den Quellen unsichtbar bleibt. Durch die Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit, Rolle und Funktion von Bildern und Filmen erforschen wir Konzepte gesellschaftlicher Ordnungen und Strukturierung sowie die Vielfalt visueller Formen und Praktiken, in denen Kulturen entlang historischer, politischer, sozialer und ökonomischer Prozesse produziert werden. Ein besonderes Augenmerk legen wie dabei auf die unterschiedlichen Gebrauchsformen audio-visueller Medien, in denen gesellschaftliche Machtverhältnisse ebenso zum Vorschein treten wie Aneignungs- und Emanzipationsprozesse.
Zentrale Themen in unseren Forschungen zu Visuellen Kulturen Südosteuropas sind:
- politische Ikonographie
- visuelle Selbst- und Fremdkonstruktionen
- audiovisuelle Aspekte gesellschaftlicher Transformationsprozesse
- historische Bild- und Filmanalyse, Intermedialität und Viskurse
- Wissenstransfer, Wissensaustausch und Netzwerke visueller Praktiken
- Genealogien audiovisueller Produktionsformen
Amateurfilmpraktiken In der Bilddatenbank VASE [Visuelles Archiv des Südöstlichen Europa] werden visuelle Daten Forschenden, Lehrenden und Studierenden zur Verfügung gestellt, um eine aktive Auseinandersetzung mit dem Medium Bild zu ermöglichen.
Menschen und Umwelt befinden sich in einer ständigen Wechselbeziehung. Aus einer historischen Perspektive betrachten wir wie Gesellschaften von ihrer Umwelt geformt werden und wie Menschen ihre Umwelt beeinflussen und wahrnehmen. Das Forschungsinteresse liegt in den kulturellen, sozialen, politischen und ökonomischen Implikationen von Naturvorstellungen und Eingriffen in Ökosysteme, sowie die sozial-räumlichen Effekte menschlichen Handelns auf die Umwelt. Unsere Forschung ist an der Schnittstelle von Umweltgeschichte und politischer Ökologie verortet, sodass wir sowohl die historische Bedingtheit als auch den politischen Rahmen des menschlichen Handelns im Bezug auf Umwelt, Natur, und Ökosysteme erfassen.
Zentrale Forschungsinteressen im Bereich der Umweltgeschichte und politischen Ökologie Südosteuropas sind:
- Umweltbildung und Umweltbewegungen in Südosteuropa
- Krieg, Umwelt und Trauma
- Politische Ökologie des Mülls
- Sozialräumliche Effekte der Mensch-Umweltbeziehung
- Visuelle Darstellungen von Natur, Umwelt und Umweltschutz
Eine Geschichtswissenschaft, die den Menschen als individuellen, sozialen und kulturellen Akteur in den Mittelpunkt ihrer Forschung stellt, wird sich weder theoretisch noch methodisch einem einzigen Konzept verschreiben. Die Wissenschaften vom Menschen erfordern eine Vielzahl an methodischen Zugriffen (naturwissenschaftliche inbegriffen). Den Kernbereich bildet in den Grazer Forschungen ein Methodenmix, der aus den Geschichtswissenschaften und der Kulturanthropologie gespeist wird. Die Arbeit in den Archiven und Bibliotheken wird durch kommunikative Forschungsstrategien ergänzt oder umgekehrt. Konkret wenden wir u.a. die historische Vergleichsmethode sowie Methoden der Erinnerungsforschung, der kommunikativen Forschung, der historischen und anthropologischen Bildforschung und der historischen Demografie an; forschungsleitend sind auch Methoden, die Mikroperspektiven, in denen der Mensch als handelnder Akteur in den Vordergrund rückt, freizulegen imstande sind.
Feldforschung - Kommunikative Forschung
Eine wichtige Methode der Historischen Anthropologie ist die Feldforschung / kommunikative Forschung. Das Verweilen im beforschten „Feld“, die Erhebung empirischer Daten durch Beobachtung und Befragung sowie die reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Position vermögen Aufschlüsse über zahlreiche soziale und kulturelle Phänomene zu geben und Prozesse der Wissensgenerierung kritisch zu beleuchten. Insbesondere dort, wo es um die Ergründung von Einstellungen und Meinungen und um die Motive von Handlungen von Akteuren geht, sind Methoden der Feldforschung / kommunikativen Forschung von besonderer Relevanz. In der betriebenen Migrationsforschung kommen vermehrt auch Methoden der multi-sited ethnography zur Anwendung, die nicht nur Akteure an verschiedenen Orten ins Visier nimmt, sondern auch eine größere interdisziplinäre Vielfalt beinhaltet, wie etwa Methoden der Cultural Studies und der Media Studies.
Historische Demografie
Der Forschungsschwerpunkt Historische Familien- und Geschlechterbeziehungen erfordert auch die Anwendung quantifizierender und demografischer Methoden in der Erforschung serieller Quellen wie Volkszählungen, Steuerlisten und Kirchenbücher. Haushaltsstrukturen werden durch demografische Ereignisse (Geburten, Heiraten, Todesfälle und Wanderungen) bestimmt und wirken andererseits auf demografische Muster zurück. Die Erforschung der historischen Verhältnisse und Entwicklungen auf den Gebieten von Fertilität, Nuptialität, Mortalität, Morbidität und Migration im Gebiet des südöstlichen Europa hat deshalb hier ein Zentrum gefunden. Besonders ausgeprägt ist die Kompetenz für den Themenkomplex Heiratsmuster und Haushaltsformierung und die Frage der historischen Entwicklung von Differenz und Übereinstimmung mit west- und zentraleuropäischen Mustern.
Historische und anthropologische Bildforschung
Ikonografische und ikonologische Einzelbildanalysen schließen den Entstehungskontext des Bildes, die verschiedenen Verwendungszusammenhänge sowie die historischen und soziokulturellen Bedingungen der Rezeption mit ein. Für den synchronen Vergleich verschiedener Bildbestände oder bei der diachronen Betrachtung eines Bildgenres oder Motivs über einen größeren Zeitraum hinweg bieten sich quantitative Fotoanalysen mithilfe der seriell-ikonografischen Methode an. Das Bildliche wird nicht nur als primäre historische Quelle verwendet, sondern es kann auch als Forschungsinstrument in der interaktiven Kommunikation – etwa in Bildinterviews – eingesetzt werden.
Mikroperspektive - Agency
Die gesamtheitliche Betrachtung des südöstlichen Europa und die Objekthaftigkeit dieser Region – abgeleitet aus der durch den Eingriff von Großmächten resultierenden Fremdbestimmung – bilden grundlegende Zugänge meist westlicher Geschichtsschreibung. Der Stellenwert derartiger Ansätze wird erst offenbar, wenn er mit mikroperspektivischen Zusammenhängen und den Handlungshorizonten der einfachen Menschen kombiniert wird. Dieses Verhältnis gilt auch umgekehrt: Grenzen und Relevanz der Lebenswelten als „ethnisch“ bezeichneter (Klein-) Gruppen wie etwa der Vlachen oder Pomaken oder auch die Reichweite der agency von Wanderhirten und ihren Familien werden erst dann in all ihren Bezügen erfassbar, wenn sie auf überregionale Prozesse bezogen werden – in diesem Fall auf die Verläufe der Nations- und Nationalstaatsbildung, die Herausbildung von Staatsgrenzen, die Siedlungsgebiete und Wanderrouten durchschneiden, und die regionalen und globalen (land-) wirtschaftlichen Entwicklungen.
Vom Vergleich zur Wechselseitigkeit
In den genannten Themenfeldern werden unterschiedliche Methoden des Vergleichs herangezogen: Ausgehend vom historischen Vergleich auf einer synchronen sowie auf einer diachronen Ebene erstreckt sich dabei das geografische Feld von innereuropäischen bis hin zu außereuropäischen Regionen. Da gerade bei der Erforschung des südöstlichen Europa ein Vergleich zwischen europäischem Normdenken und den Abweichungen von dieser Norm, die vor allem dem Balkan angeheftet wird, nahezuliegen scheint, wird diese bereits in vieler Hinsicht vorformulierte Richtig-falsch-Dichotomie kritisch beleuchtet sowie dekonstruiert. Statt der Suche nach Differenz oder dezidierter Gemeinsamkeit wird die Komplexität und die wechselseitige Beeinflussung, wie etwa durch das Osmanische Reich und durch muslimische Kulturen, in den Mittelpunkt der Forschungsinteressen gerückt. Ein Vergleich wird damit in seiner Grundtendenz das kulturelle Spiegelbild des „Eigenen“.
KI in der südosteuropäische Geschichte und Anthropologie
Künstliche Intelligenz macht auch vor der Zunft der Historiker:innen nicht halt. Immer mehr Lehrende und Studierende nutzen KI-Tools ― allerdings mit variabler Qualität der Ergebnisse und Transparenz. Wir, die Lehrenden und Forschenden des AB, sind der festen Überzeugung, dass diese Kompetenz für Forschende, Lehrende und Studierende unverzichtbar sein wird. In Anlehnung an den KI-Orientierungsrahmen der Uni Graz sehen wir daher die Förderung von sog. „future skills“ wie die der KI-Kompetenz als integraler Bestandteil der Ausbildung. Wir betrachten die KI sowohl als Gegenstand (kritische Analyse und Beurteilung der “Outputs” und Auswirkungen) als auch als Werkzeug (Potenzial in Bereichen wie digitale Barrierefreiheit oder kreative Methoden) von Studiums und Lehre, und binde sie aktiv in unsere Lehre ein. Ziel ist es, dass die Studierenden grundlegende Kompetenzen im Umgang mit KI erwerben und in der Lage sind, die verschiedenen Tools zielgerichtet für Lern- und Forschungszwecke einzusetzen und die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Dieser Schwerpunkt bietet mehr Raum für forschendes Lernen und die kritische Reflexion des eigenen Forschungsprozesses. Damit rückt die Prozesshaftigkeit der Forschung in den Vordergrund unserer Lehre und Bewertung gegenüber den traditionell ergebnisorientierten Lehrmethoden und Bewertungsschemata.
ARCHIV: Blick zurück
Was bisher geschah – wichtige Ereignisse und die Entwicklung unseres Arbeitsbereichs

Zur Geschichte des Lehrstuhls und den Räumlichkeiten
Die Gründung der „Lehrkanzel für Südosteuropäische Geschichte“ am Historischen Institut der Universität Graz erfolgte im Jahre 1970 in der Nachfolge der ehemaligen Lehrkanzel für Byzantinische Philologie und Geistesgeschichte. Die Lehrtätigkeit wurde im Wintersemester 1970 aufgenommen. Nach der Einführung des Universitätsorganisationsgesetzes 1975 wurde das Institut in „Institut für Geschichte“ und die ehemalige Lehrkanzel im „Fachbereich für Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie“ umbenannt. Erster Leiter der Lehrkanzel bzw. Abteilung war Ferdinand Hauptmann, zuvor Professor für Allgemeine Neuere Geschichte an der Universität Sarajevo. Seine Emeritierung erfolgte 1986. 1988 ist ihm Horst Haselsteiner (bis dahin Assistent am Institut für Ost- und Südosteuropaforschung der Universität Wien) nachgefolgt. Nach dessen Berufung an die Universität Wien als Ordinarius in der Nachfolge von Richard Georg Plaschka (1993) hat 1996 Karl Kaser, bis dahin Vertragsassistent an der Abteilung, das Ordinariat und die Abteilungsleitung übernommen.
Standort: Meerscheinschlössl
Der Fachbereich befindet sich im Nordtrakt des historischen Meerscheinschlössls – einem barocken Bauwerk mit bewegter Geschichte. Ursprünglich im 16. Jahrhundert vermutlich als Residenz des päpstlichen Nuntius für Innerösterreich errichtet, erhielt das Gebäude seinen heutigen Namen im 19. Jahrhundert von einem Cafétier. Damals wurde in den Räumen getanzt, Karten gespielt und Kaffee getrunken – eine Tradition, die sich zumindest in letzterer Form bis heute gehalten hat.
Trotz des idyllischen Ambientes täuscht der erste Eindruck: Auf rund 500 Quadratmetern Bibliotheks- und Arbeitsfläche wird auf drei Etagen intensiv geforscht, diskutiert und gearbeitet. Der Fachbereich setzt auf Internationalisierung, den Ausbau wissenschaftlicher Netzwerke und aktive Kommunikation – regional wie global.
Karl Kaser (1954-2022)
Karl Kaser war ab 1996 Professor für Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie an der Universität Graz. Er prägte den Fachbereich über viele Jahre hinweg maßgeblich und setzte wichtige Impulse in Forschung und Lehre.
Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte lagen in der historischen Anthropologie, insbesondere in den Bereichen Familien- und Verwandtschaftsgeschichte, Geschlechterordnungen und visueller Kultur in Südosteuropa. Mit seinen interdisziplinären Ansätzen und zahlreichen Publikationen zählt Kaser zu den bedeutendsten Südosteuropahistorikern im deutschsprachigen Raum.

4STUDENTS: Studienrelevante Themen
Ob BA oder MA – hier gibt’s Infos zu Lehrveranstaltungen, Betreuung, Abschlussarbeiten und allem, was das Studium betrifft.
Univ.-Prof. Dr. Heike Karge
Emotionen. Historische und anthropologische Zugänge, SE, 2st.
Introduction into Intersectional Memory Studies, SE, 2st.
Current debates on Southeast European history and anthropology, PV, 2st.
Einführung in das Studium der Zeitgeschichte, PS, 2st.
Ao.Univ.-Prof.i.R. Dr.h.c.mult. Dr.phil. Harald Heppner/ Priv.-Doz. Dr.phil. MA. Ingeborg Zechner
Die Aufklärung des 18.Jh. und ihre ambivalenten Effekte, DQ, 2st.
Mag. Dr.phil. Christian Promitzer
Introduction to the History and Anthropology of Southeast Europe (Essentials, Theories, and Methods), VU, 2st.
Mag. Ma. Ma. Zsófia Turóczy
Texte im Kontext: Kulturgeschichtliche Perspektiven auf die albanische Literatur, VU, 2st.
Ottoman Heritage in Southeast Europe, UE, 2st.
BA. MA. MA. Christina Sterniša
Erinnerungsorte des Widerstands im städtischen Raum, UE, 2st.
Mag. Dr.Phil. Ulrike Tischler-Hofer
Die Darstellung von „Provinz“ in der europäischen Reiseliteratur (langes 18. Jahrhundert bis 1914), VU, 2st.
Studierende haben die Möglichkeit, ihre Bachelor- oder Masterarbeit zu Themen aus dem Bereich Geschichte und Anthropologie Südosteuropas zu verfassen. Die Betreuung erfolgt durch drei ausgewiesene Expert:innen mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten.
Univ.-Prof. Dr. Heike Karge
Forschungsschwerpunkte:
- Kultur- und Sozialgeschichte Südosteuropas (19.–21. Jahrhundert)
- Medical Anthropology
- Kulturgeschichte von Krankheit und Gesundheit
- Psychiatriegeschichte
- Interdisziplinäre Traumaforschung im 20. Jahrhundert
- Erinnerungskulturen und Erinnerungspolitik
- Internationale Schulbuchforschung
Mag. MA MA Zsófia Turóczy
Forschungsschwerpunkte:
- Kulturgeschichte und Literatur Südosteuropas (insb. Ungarn, Türkei, Kosovo, Albanien)
- Elitenetzwerke in historischer Perspektive (z. B. Freimaurer)
- Wechselwirkungen zwischen Literatur und Geschichte
- Selbst- und Fremdbilder
- Historische und kritische Diskursanalyse (Wiener Schule)
- Erinnerungskultur mit Fokus auf materielle Repräsentationen (z. B. Museen)
Mag. Dr. phil. Christian Promitzer
Forschungsschwerpunkte (allgemein, ohne regionale Einschränkung):
- Sozialgeschichte der Medizin
- Historische Anthropologie von Gesundheit und Krankheit
- Geschichte von Epidemien
- Historische Biopolitik (Rassenanthropologie, Eugenik, Bevölkerungspolitik)
Mit Schwerpunkt auf Südosteuropa:
- Alle oben genannten Themenfelder
- Geschichte Sloweniens und der südslawischen Länder
- Sozialgeschichte der Grenzen (Militärgrenze, Staatsgrenzen)
- Imagologie / interkulturelle Hermeneutik (z. B. Balkanismus, Orientalismus)
Bei Interesse an einer Abschlussarbeit wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Betreuungsperson. Wir freuen uns über thematisch passende Vorschläge und begleiten Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Forschungsvorhaben!
Im Rahmen des Arbeitsbereichs Südosteuropäische Studien und Anthropologie wird pro Studienjahr eine Exkursion angeboten, die Studierenden die Möglichkeit bietet, regionale Schwerpunkte vor Ort kennenzulernen. Ziel dieser Reisen ist es, theoretische Inhalte mit praktischen Einblicken zu verbinden und ein vertieftes Verständnis für kulturelle, soziale und historische Zusammenhänge in Südosteuropa zu fördern.
Studiumjahr 2024: Krieg, Nation und Erinnerung in der Lika (YouTube-Video der Studierenden)
Studiumjahr 2025: Multidimensionale Erinnerung in Bosnien und Herzegowina